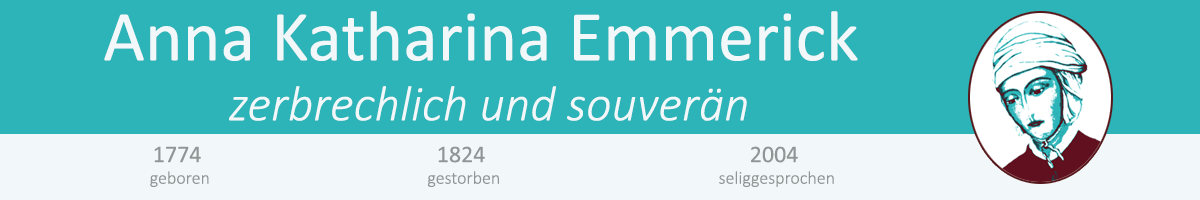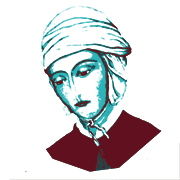Zeugnisse des klösterlichen Lebens sind jetzt bei Ausgrabungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Dülmen zum Vorschein gekommen. Wo im Osten der Stadt ein Parkplatz entstehen soll, stand bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts das Kloster Agnetenberg. Insbesondere die archäologischen Funde des späten 15. und 16. Jahrhunderts geben einen Eindruck vom geistlichen Alltag, der auch die seliggesprochene Mystikerin Anna Katharina Emmerick hier bis 1812 geprägt hat.
Dr. Hans-Werner Peine von der LWL-Archäologie für Westfalen rechnete bereits im Vorfeld der Ausgrabung damit, an der Münsterstraße auf die Reste des früheren Augustinerinnenklosters zu stoßen. "An dieser Stelle wurde nach der Säkularisierung vom Herzog von Croy der Bau einer Rentei veranlasst", schildert der Fachmann für Mittelalter- und Neuzeitarchäologie. Hierfür wurden Teile des Klosters abgerissen. Ein Rest seiner Grundmauern kam nun jedoch wieder zum Vorschein. Für Grabungsleiter Dr. Gerard Jentgens kamen die Befunde überraschend früh: "Die ersten Grundmauern der Rentei lagen bereits dicht unter der Oberfläche, etwa 20 cm unter dem Straßenniveau."
Es sind zwar nur wenige Mauern, die von den Archäologen dort dokumentiert werden konnten, wo sich einst der Südabschluss des 1457 gestifteten Klosters befand. Die Mauern hatten lange vertikale Nischen und trugen einen Fachwerkbau. Im Inneren warteten jedoch weitere Funde auf die Fachleute. So enthielt die Kellerverfüllung auch Hinweise darauf, wie der Speisenzettel der Nonnen einst ausgesehen hat. Fisch bereicherte das schlichte Mahl, wie die organischen Reste zeigen. Ein Gewicht, ein Brillenfragment, Ofen- und Gefäßkeramik bilden die weiteren Funde.
Außergewöhnlich ist die Entdeckung von Fragmenten, die von Andachtsbildern als besonderen Zeichen der Frömmigkeit stammen. Die Tafeln war aus weißem Pfeifenton hergestellt worden. "Davon konnten wir jetzt Teilstücke bergen", schildert Jentgens. Auf einem Andachtsbild ist eine Heilige in einem hoch gegürteten Kleid und Mantel zu sehen. Sie trägt Krone und Nimbus. In der rechten Hand hält sie ein Buch, in der linken eine Zange mit Zahn. "Daraus lässt sich schließen, dass hier die Heilige Apollonia abgebildet ist", erläutert der Grabungsleiter. Eine Legende erzählt davon, dass der Heiligen während der Marter ausgebrochene Zähne nachwuchsen.
Hergestellt wurden solche Bilder in der Nähe im Kartäuserkloster Dülmen-Weddern. Das zeigt die Signatur des Künstlers, die auf dem jetzt entdeckten Andachtsbild erhalten ist. Dabei handelt es sich um Judocus Vredis, der seit 1493 Mitglied des Konvents in Dülmen-Weddern war. Er entwarf die religiösen Motive.
Die Reste der herzoglichen Rente dominieren den Norden des Bauplatzes. "Die Backsteinfundamente sind mächtig", resümiert Jentgens. Der repräsentative Bau war zweigeschossig und hatte einen zur Straße ausgerichteten Mittelgiebel. Die Rentei war die Hofkammer und verwaltete die Einkünfte des Herzogs. Er hatte bereits 1802 das Amt Dülmen als Ausgleich für seine an Frankreich abgetretenen Besitztümer links des Rheins erhalten. Dazu gehörte auch das Recht, den geistlichen Grundbesitz einzuziehen. Das Kloster Agnetenberg ließ er zunächst bestehen, weil die acht Nonnen Schulunterricht für die Bürgertöchter erteilten. In diese Zeit des Umbruchs fiel auch die Aufnahme von Anna Katharina Emmerick in das Kloster im Jahr 1803, die bereits zu Lebzeiten einige Berühmtheit über die Region hinaus erlangte.
Die Kötterstochter, die zuvor als Magd, Näherin und Hausmagd arbeitete, lebte hier bis zur Auflösung des Klosters im Jahr 1812. Sie verließ als Letzte das Kloster, das trotz harten Ringens für sie wichtig war: "Ich war nirgends glücklicher als im Kloster", ist von ihr überliefert. In den folgenden Jahren lebte sie in ärmlichen Verhältnissen in Dülmen und trug seit 1813 die Wundmale Jesu. Zahlreiche prominente Zeitgenossen wie Clemens von Brentano, Bettina und Achim von Arnim, spätere Bischöfe und Fürstbischöfe pilgerten aus diesem Grund an das Krankenbett, das die Mystikerin bis zu ihrem Tod 1824 nicht mehr verlassen hat. 2004 wurde Anna Katharina Emmerick selig gesprochen.
Die Ausgrabungen sind jetzt nach insgesamt zwei Wochen beendet worden. Die Archäologen begleiten auch die weiteren Bauarbeiten und behalten mögliche archäologische Funde im Blick.
Dr. Gerard Jentgens